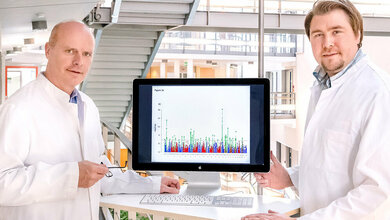Ein schwerer Unfall, eine Naturkatastrophe, der Verlust eines geliebten Menschen oder Krieg und Gewalt können zu einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) führen. Eine PTBS kann unmittelbar nach dem traumatischen Ereignis auftreten oder erst Monate oder sogar Jahre später beginnen und das tägliche Leben erheblich beeinträchtigen. Im Lauf ihres Lebens erkranken knapp acht Prozent aller Menschen an einer PTBS, wobei Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Es gibt jedoch gute Aussichten auf Heilung. „Je eher eine PTBS professionell psychotherapeutisch behandelt wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, den Alltag wieder normal gestalten zu können“, sagt Prof. Dr. Jürgen Deckert, Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Uniklinikum Würzburg (UKW), die einen ihrer Schwerpunkte auf die Erforschung und Behandlung von PTBS gelegt hat.
Genetische Untersuchungen zu PTBS
In einer veröffentlichten Studie analysierte das Psychiatric Genomic Konsortium, zu dem auch Mitglieder des Würzburger Zentrums für Psychische Gesundheit (ZEP) und ihre Kooperationspartner aus dem ehemaligen Jugoslawien gehören, die genetischen Merkmale von PTBS. „Veranlagungsfaktoren können die Menschen resilienter oder vulnerabler gegenüber Extremerfahrungen machen“, erläutert Jürgen Deckert: „Nicht alle entwickeln nach einem traumatischen Ereignis eine Posttraumatische Belastungsstörung.“ Insgesamt wurden die Daten von mehr als 1,2 Millionen Menschen unterschiedlicher Herkunft analysiert. Von den 95 entdeckten genetischen Bereichen, die mit PTBS in Verbindung stehen, seien 80 zuvor unbekannt gewesen. „Bei der genaueren Untersuchung dieser genetischen Bereiche haben wir 43 Gene identifiziert, die das Risiko erhöhen, nach einem Trauma eine Posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln“, berichtet Privatdozentin Dr. Heike Weber. Die Biologin leitet am ZEP das Labor für funktionelle Genomik und hatte in einer früheren Studie in einer Kohorte aus Kriegsgebieten in Südosteuropa (SEE-PTBS-Kohorte) den relativen Beitrag genetischer Faktoren im Vergleich zur Schwere des Traumas und Bewältigungsstrategien untersucht. Weber zufolge sind diese 43 neu identifizierten Gene hauptsächlich für die Regulation von Nervenzellen und Synapsen, die Entwicklung des Gehirns, die Struktur und Funktion von Synapsen sowie für hormonelle und immunologische Prozesse zuständig. Weitere wichtige Gene beeinflussen Stress- und Angst- und Bedrohungsprozesse, von denen man annimmt, dass sie der Neurobiologie der PTBS zugrunde liegen.
Molekulare Ursachen von PTBS und Depressionen
Eine weitere Studie geht auf die molekularen Ursachen sowohl von PTBS als auch von Depressionen ein. Beide stressbedingten Störungen entstehen durch das Zusammenspiel von genetischer Anfälligkeit und Stressbelastung, welche nach und nach zu Veränderungen im menschlichen Genom führen, die die Expression von Genen und Proteinen beeinflussen. Um eine integrierte Systemperspektive von PTBS und Depression zu erlangen, hat das internationale Team die Daten aus Untersuchungen von verschiedenen Gehirnregionen mit Analysen der Einzelkern-RNA-Sequenzierung, der Genetik und der Proteomik des Blutplasmas ergänzt. Die Forschenden fanden die meisten Krankheitssignale im medialen präfrontalen Kortex (mPFC). Diese betreffen das Immunsystem, die Regulierung von Nervenzellen und von Stresshormonen.
Hinweise auf neue therapeutische Ansätze
Die Ergebnisse zeigen gemeinsame und unterschiedliche molekulare Störungen im Gehirn bei PTBS und Depression, sie klären die Beteiligung spezifischer Zelltypen auf, ebnen den Weg für die Entwicklung blutbasierter Biomarker und unterscheiden zwischen Risiko- und Krankheitsprozessen. Das heißt: Die Erkenntnisse weisen auf stressbedingte Signalwege hin und liefern Hinweise auf neue therapeutische Ansätze in Ergänzung der bisherigen psychotherapeutischen Interventionen.
Quelle: idw/Universitätsklinikum Würzburg
Artikel teilen