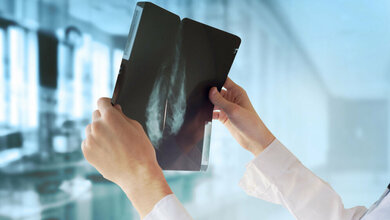Von 1.000 Frauen, die zehn Jahre lang zur Mammographie gehen, werden etwa eine oder zwei vor dem Tod durch Brustkrebs bewahrt durch ein frühzeitiges Erkennen des Tumors. Doch diesem potenziellen Nutzen stehen mögliche Nachteile, wie die Strahlenbelastung, die unnötige Beunruhigung bei einem falsch positiven Befund und Überdiagnosen, gegenüber. Eine personalisierte Früherkennung könnte die Situation verbessern, indem sie an das individuelle Brustkrebsrisiko angepasst ist. Das Ziel des DKFZ ist es, die Balance in Richtung des Nutzens zu verschieben.
Frauen mit einem hohen Brustkrebsrisiko haben natürlich auch den größten Nutzen von der Mammographie. „Diesen Frauen könnten engmaschige Mammographien angeboten werden, möglicherweise sollten sie mit dem Screening auch schon im Alter von 45 Jahren beginnen. Bei Frauen mit niedrigerem Risiko dagegen würden längere Intervalle zwischen den Mammographien ausreichen,“ so Rudolf Kaaks vom DKFZ.
Für die Vorhersage des individuellen Brustkrebsrisikos haben die Wissenschaftler mathematische Modelle entwickelt. Diese basieren in erster Linie auf Daten aus der Reproduktionsgeschichte: In welchem Alter fand die erste Regelblutung statt? Wann wurde das erste Kind geboren und wie viele Kinder waren es insgesamt? Wann sind die Wechseljahre eingetreten? Wurde hormonell verhütet oder eine Hormonersatztherapie eingenommen? Auch die Anzahl der Krebsfälle bei direkten Angehörigen wird mit einbezogen sowie der Body-Mass-Index.
Wird der Hormonspiegel mit einberechnet, werden die Modelle noch genauer – zumindest bei Frauen nach den Wechseljahren. Dies fand Annika Hüsing aus der Abteilung von Rudolf Kaaks heraus. Sie nutzte hierfür Blutproben von Teilnehmerinnen der EPIC-Studie – der großen europäischen Untersuchung zu Ernährung, Lebensstil und Krebs. Die ermittelten Konzentrationen von Östradiol und Testosteron verbesserten die Vorhersagekraft erheblich. Mit diesen Ergebnissen konnten auch erstmals die Ergebnisse einer Studie aus Harvard bestätigt werden.
Regionale Unterschiede
Diese Modelle sind jedoch nicht konzipiert für Frauen mit einer Mutation der „Brustkrebsgene“ BRCA1 und BRCA2. Neben diesen Mutationen gibt es jedoch auch viele kleine Genvarianten, die jeweils einen minimalen Einfluss haben – gemeinsam können sie das Brustkrebsrisiko jedoch spürbar steigern. Die Reichweite dieses Einflusses wird derzeit in großen internationalen Forschungskonsortien ermittelt, an denen auch die Epidemiologen des DKFZ um Kaaks beteiligt sind. Solche genetischen Risikoprofile sollen als weitere biologische Marker in die Modelle mit einberechnet werden.
Außerdem müssen die Berechnungen an die jeweilige Bevölkerungsgruppe angepasst werden. Hüsing arbeitet daran, die auf Daten aus den USA beruhenden Modelle an deutsche Verhältnisse anzupassen. „Bei uns sind die Frauen älter, wenn sie ihr erstes Kind zur Welt bringen, und sie haben auch insgesamt weniger Kinder als Frauen in den USA. Außerdem wird die Verschreibung von Hormontherapien anders gehandhabt.“ (DKFZ, red)
Hüsing A, Fortner RT, Kühn T, et al.: Added Value of Serum Hormone Measurements in Risk Prediction Models for Breast Cancer for Women Not Using Exogenous Hormones: Results from the EPIC Cohort. Clin Cancer Res. 2017 DOI:10.1158/1078-0432.CCR-16-3011.
Paige Maas, Myrto Barrdahl, et al.: Breast Cancer Risk From Modifiable and Nonmodifiable Risk Factors Among White Women in the United States. JAMA Oncology 2016, DOI 10.1001/jamaoncol.2016.1025.
Artikel teilen