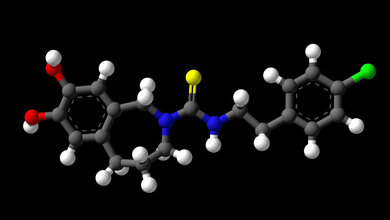Es existieren momentan lediglich abgelaufene Leitlinien für die Diagnostik und für die Behandlung chronischer Nervenschmerzen. Da diese aktuellen Leitlinien noch keine Ultraschallempfehlung enthalten, sollten sie nach Ansicht der Experten dringend überarbeitet werden.
Schmerzen entstehen nach einer Gewebeschädigung und dienen in erster Linie der Ruhigstellung verletzter Gewebe. Damit haben Schmerzen eigentlich eine Schutzfunktion, um einen Heilungsprozess zu begünstigen oder einer Verschlimmerung des Gewebeschadens vorzubeugen. „Unter normalen Umständen ist der Schmerz mit Eintreten der Heilung beziehungsweise der Geweberegeneration rückläufig“, erläutert DEGUM-Expertin Dr. Carla Alessandra Avila González von der Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Palliativ- und Schmerzmedizin am BG Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum.
„Wenn der Gewebeschaden jedoch so groß ist, dass eine Regeneration nicht oder nur sehr langsam erfolgt, oder der Schmerz seine Warnfunktion verliert und sich verselbstständigt, können daraus chronische Schmerzen entstehen.“ Häufig sind Störungen im Nervensystem die Ursache für die lang anhaltenden Beschwerden.
Selbst kleinste Nervenäste können erkannt werden
Um der Ursache chronischer Schmerzen auf die Spur zu kommen, nimmt der behandelnde Arzt zunächst eine sorgfältige Anamneseerhebung – also ein Patientengespräch – und dann eine genaue körperliche Untersuchung vor. Bei speziellen Fragestellungen, wie zum Beispiel bei Schmerzen infolge einer Verletzung großer Nerven oder bei Nerventumoren, werden bildgebende Verfahren wie die Computer- oder Kernspintomografie eingesetzt. Diese Techniken können jedoch verfahrensbedingt nicht bei allen Patienten angewendet werden, und sie sind in der Darstellung kleiner Strukturen limitiert.
Außerdem kommen elektrophysiologische Verfahren zum Einsatz. Hier werden die Nervenleitgeschwindigkeit (NLG) und Hirnströme, die sich durch die Reizung peripherer, sensorischer Nerven erzeugen lassen, gemessen. Ultraschalluntersuchungen werden in der Schmerzdiagnostik bisher noch nicht allgemein genutzt, doch nach Ansicht der DEGUM sollten sie künftig verstärkt zum Einsatz kommen.
„Dank modernster, hochfrequenter Ultraschalldiagnostik können mittlerweile selbst kleinste Nervenäste, die Schmerzen verursachen, erkannt werden. Diese würden bei anderen diagnostischen Verfahren verborgen bleiben“, so Avila González. „Die hochauflösenden Schallsonden ermöglichen beispielsweise, dass selbst Strukturen oder Verletzungen, die kleiner als einen Millimeter groß sind, an peripheren Nerven entdeckt werden können. Zu diesen gehören zum Beispiel kleine Fremdkörper oder Einengungen von Nervenendästen im Narbengewebe.“
Ultraschalldiagnostik - strahlenfrei und besonders schonend
Neben der exakten Darstellung hat die sonografische Darstellung gegenüber anderen Verfahren weitere Vorteile: „Die Ultraschalldiagnostik kann strahlenfrei und somit besonders schonend durchgeführt werden“, sagt die Expertin. Wenn der Verdacht besteht, dass die Nervenschädigung Auslöser der Schmerzen ist, kann mittels einer ultraschallgesteuerten hochpräzisen Injektion kleinster Mengen von Betäubungsmitteln – sogenannter Lokalanästhetika – am suspekten Nerv Schmerzfreiheit erzielt werden. So kann die Verdachtsdiagnose bestätigt werden.
Damit chronische Schmerzen mittels Ultraschall möglichst exakt diagnostiziert werden können, benötigt der behandelnde Arzt neben dem geeigneten Ultraschallgerät auch exzellente anatomische Kenntnisse und sonografische Fertigkeiten. Die DEGUM-Experten lehren solche Kenntnisse und Fertigkeiten in speziellen Kursen. Sie setzen sich dafür ein, dass die Ultraschallverfahren in der Schmerzdiagnostik künftig verstärkt zum Einsatz kommen.
„Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass die abgelaufenen Leitlinien für die Diagnostik und für die Behandlung chronischer Nervenschmerzen überarbeitet werden“, meint Avila González. „Die bisherigen Leitlinien basieren mangels valider wissenschaftlicher Daten lediglich auf der Meinung einiger Experten. Aus unserer Sicht sind daher dringend wissenschaftliche Untersuchungen zum Stellenwert der Sonografie sowohl in der Diagnostik als auch in der Behandlung chronischer Schmerzen erforderlich.“
Deutsche Schmerzgesellschaft e.V.
Baron, R.; Koppert, W.; Strumpf, M.; Willweber, A. (Hrsg.), Praktische Schmerztherapie, 3. aktualisierte und erw. Auflage 2014
Pharmakologisch nicht interventionelle Therapie chronisch neuropathischer Schmerzen. Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie, Deutsche Gesellschaft für Neurologie, Klasse: S1, veröffentlicht September 2012, ergänzt 7.1.2014, gültig bis 29.9.2017
Diagnostik neuropathischer Schmerzen. Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie, Deutsche Gesellschaft für Neurologie, Klasse: S1, veröffentlicht September 2012, gültig bis Dezember 2016, verlängert bis 29.09.2017
Quelle: idw/DEGUM, 08.08.2018
Artikel teilen