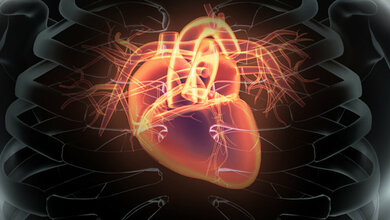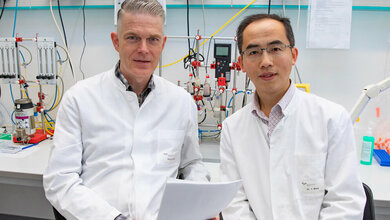Die kardiale Magnetresonanztomografie hat sich als Goldstandard für die Beurteilung von Funktion und Gewebeschaden des Herzmuskels nach einem Infarkt erwiesen. Vor allem nach STEMI*, von dem rund 40 Prozent der Herzinfarkt-Patienten betroffen sind, ist die Beurteilung der individuellen Prognose mittels MRT entscheidend. „Nach der erfolgreichen Wiedereröffnung des verschlossenen Herzkranzgefäßes sehen wir bei rund 50 Prozent der STEMI-Patienten sogenannte mikrovaskuläre Gefäßverschlüsse im MRT. Diese sind nicht behandelbar, galten aber bislang als Marker für eine schlechte Prognose. Deshalb zielten bisherige Studien darauf ab, neue Ziele für die Behandlung der MVO (Anmerkung: mikrovaskuläre Gefäßverschlüsse) zu finden“, erklärt Studienleiter Sebastian Reinstadler von der Uni.-Klinik für Innere Medizin III, Kardiologie und Angiologie (Direktor: Axel Bauer), wo pro Jahr rund 1.000 Herzinfarkt-Patienten akut behandelt werden.
Neuer unabhängiger Prognosemarker
Mit IMH (intramyokardiale Einblutung), einem Schädigungsmuster, das in circa der Hälfte der Patientinnen und Patienten mit MVO zu finden ist und eine ausgedehnte Entzündung mit Eisenablagerungen im Herzmuskel anzeigt, sei es den Forschenden nun gelungen, einen neuen unabhängigen Prognosemarker zu identifizieren. Dieses Ergebnis habe nicht nur für die Optimierung der Risikoabschätzung, sondern vor allem auch für die Entwicklung neuer Therapiestrategien, die auf die mikrovaskuläre Schädigung abzielen, besondere Relevanz. „Nun stellt sich die Frage, ob spezifische Therapiestrategien nach einem Herzinfarkt (STEMI) das Outcome von Patienten mit IMH verbessern. Diese Hypothese ist nun Gegenstand weiterer Studien“, betont Reinstadler.
Daten aus vier Herzzentren analysiert
Um die prognostische Relevanz verschiedener, mittels MRT darstellbarer Schädigungsmuster des Herzmuskels zu überprüfen, wurden prospektiv Daten von insgesamt 1.109 STEMI- Patienten – der bislang größten, jemals in eine klinische Studie eingeschlossenen STEMI-Population – aus vier Herzzentren (Innsbruck, Lübeck, Leipzig und Glasgow) analysiert. Die Kohorte wurde in drei Gruppen eingeteilt: Patienten ohne Mikrovaskuläre Gewebeschäden (weder MVO noch IMH), Patienten mit Mikrovaskulären Gefäßverschlüssen, aber ohne Einblutung in den Herzmuskel (MVO+/IMH) und Patienten mit Einblutung in den Herzmuskel (IMH+). „Wir stellten fest, dass in der Gruppe der Patienten mit Einblutung in den Herzmuskel nach durchschnittlich zwölf Monaten ein unerwünschtes kardiales Ereignis häufiger auftrat, als in den beiden anderen Untergruppen“, bestätigt Erstautor Ivan Lechner. Patienten mit Mikrovaskulären Gefäßverschlüssen und ohne intramyokardiale Einblutung hätten hingegen eine ähnliche Prognose wie Patienten ohne jegliche mikrovaskuläre Schädigung gehabt.
Neue therapeutische Ansätze als Priorität
„Es wird vermutet, dass im Umbauprozess nach Herzinfarkt, Gefäße aufbrechen, wodurch Erythrozyten ins Infarktgewebe gelangen, die von Makrophagen, großen Immunzellen, aufgenommen werden und dort Eisen ablagern. Dadurch könnten Entzündungsprozesse angetrieben werden, die eine schlechte Prognose begünstigen“, erklärt Ivan Lechner. Diese molekularen Grundlagen sowie die Frage, ob die Infarktgröße für das Ausmaß der IMH ausschlaggebend sei, bedürften einer weiteren Aufklärung. Auch wenn eine intramyokardiale Einblutung bislang nicht verhindert werden könne, sollte die klinische Erforschung neuer therapeutischer Ansätze für die IMH Priorität haben. In der Zwischenzeit sollten betroffene Patienten jedenfalls engmaschig überwacht werden. Die unabhängige prognostische Bedeutung der IMH bei der Beurteilung des Risikos nach STEMI werde jedenfalls Eingang in ein überarbeitetes Konsensuspapier zur Risikostratifizierung nach Herzinfarkt finden, sind sich die Studienautoren sicher.
*) Der ST-Hebungsinfarkt (STEMI) ist ein Myokardinfarkt, bei dem das EKG ST-Hebungen zeigt.
Quelle: idw/Med Uni Innsbruck
Artikel teilen