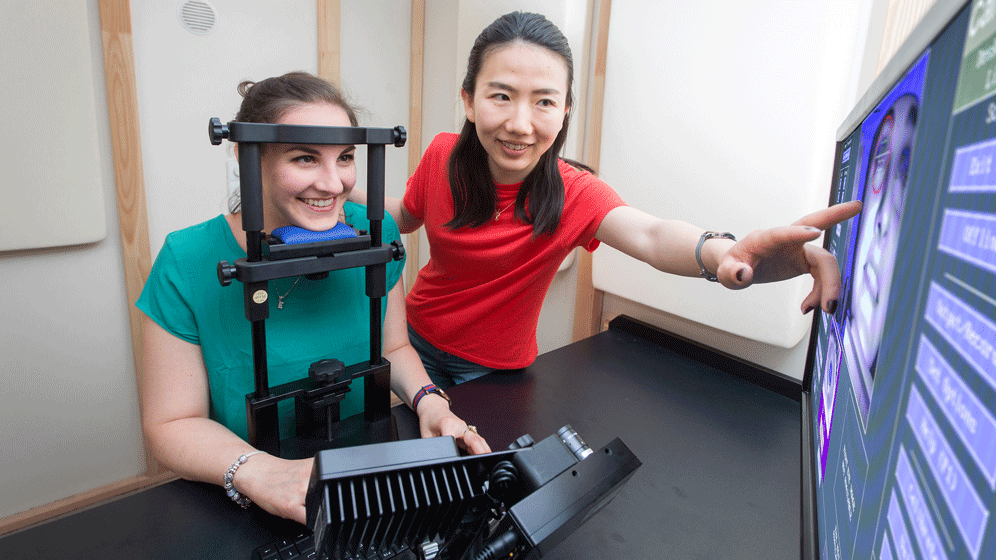Bisher wurde davon ausgegangen, dass spezialisierte Wahrnehmungs- und Handlungsareale anatomisch klar voneinander getrennt existieren. Nun hat sich gezeigt, dass diese Areale miteinander lokal interagieren. Die neuen Erkenntnisse führen zu einem besseren Verständnis davon, wie Hirnfunktionen strukturiert sind und könnten für Patienten mit Störung der Gesichtswahrnehmung relevant sein.
Die Forschungsergebnisse der Arbeitsgruppe Allgemeine Psychologie am Institut für Psychologie der Universität Magdeburg unter Leitung von Prof. Dr. Stefan Pollmann wurde soeben im internationalen Fachjournal Nature-Communications veröffentlicht.
In dem in zwei Phasen durchgeführten Projekt wurden zunächst die Bewegungen der Augen – also die Handlungen – von Probanden erfasst, während sie Gesichter und Häuser betrachteten. Daraus ließen sich sogenannte Blickbewegungsmuster ableiten, die jeweils für die betrachteten Gegenstände typische Strukturen aufweisen.
Eine enge Interaktion von Wahrnehmung und Handlung
In der zweiten Phase wurden diese Blickbewegungsmuster den Probanden als Serie von schwarzen Punkten auf einem grauen Hintergrund vorgespielt. Diesen Punkten sollten die Probanden mit ihren Blicken folgen, ohne zu wissen, dass es sich um definierte Blickbewegungsmuster handelt und ohne Bilder von Gesichtern oder Häusern zu sehen. Die kombinierte Aufzeichnung von Blickbewegung und Hirnaktivität durch funktionelle Magnetresonanztomografie ermöglichte es, den Blickbewegungsmustern eine bestimmte Hirnaktivität zuzuordnen. Das heißt, ohne dass ein Gesicht oder ein Haus zu sehen war, wurden allein durch das Betrachten der Blickbewegungsmuster zwei Hirnareale aktiviert, die sonst bei der Wahrnehmung von Gesichtern und Häusern eine bedeutende Rolle spielen.
„Diese Befunde zeigen, dass neuronale Prozesse von Wahrnehmung und Handlung im Großhirn enger miteinander interagieren, als bisher angenommen“, schätzt Prof. Dr. Stefan Pollmann ein. Dies sei auch für sein Team ein recht überraschendes Ergebnis gewesen. „Es steht jedoch im Einklang mit psychologischen Verhaltensbefunden, die eine enge Interaktion von Wahrnehmung und Handlung gezeigt haben. Damit eröffnet sich jetzt ein weites Feld für weitere Forschung dazu, welche funktionelle Bedeutung dieser Befund für die gesunde wie pathologische visuelle Wahrnehmung hat“, gibt Pollmann einen Ausblick auf weitere Forschungen.
Quelle: idw/Universität Magdeburg, 09.12.2019
Artikel teilen