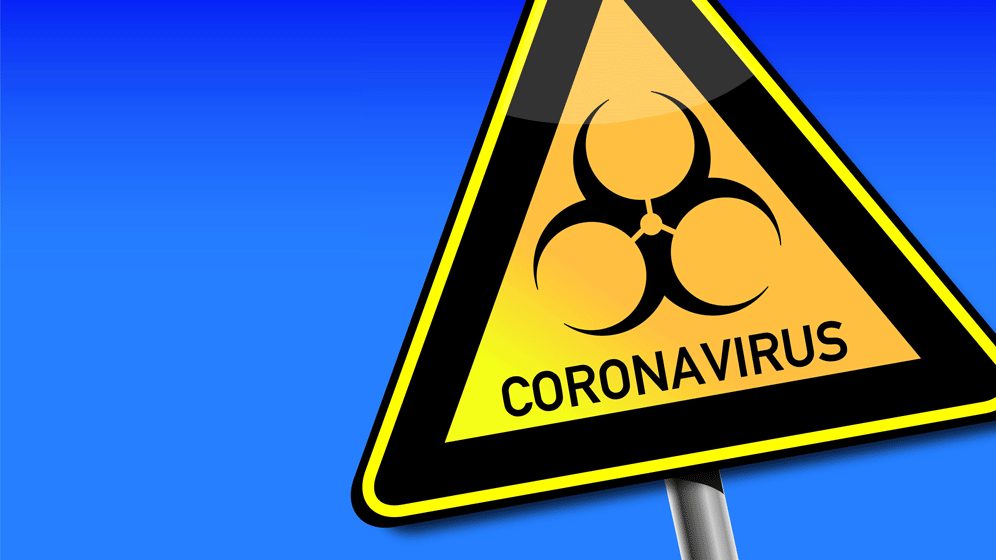Bisher gab es bei Untersuchungen mit Radiopharmazeutika zum Teil Probleme bei langen Aufenthaltsdauern von radioaktiven Substanzen in den Nieren. Mit der Entwicklung einer neuen Klasse von Radiopharmazeutika konnten die Forscherinnen und Forscher das Problem nun reduzieren. Ihr Ansatz beruht auf einem zusätzlichen Protein, das in den Nieren gespalten werden kann. Diese Spaltung löse die radioaktive Substanz vom Medikament, wodurch diese direkt in den Harnweg gelangt, über den sie ausgeschieden werden könne, so die Wissenschaftler/-innen.
Suche nach geeigneten Radiopharmazeutika
In der Regel bestehen die Radiopharmazeutika zum Aufspüren von Tumoren im Körper aus einem Radionuklid und einem Bio-Molekül. Das Bio-Molekül, zum Beispiel ein Antikörper oder ein Peptid, bindet spezifisch an bestimmte Oberflächenstrukturen von Geweben. Dadurch, dass das Radionuklid Strahlung abgibt, kann dies genutzt werden, um einen Tumor aufzuspüren oder ihn zu zerstören.
Das Prinzip klingt einfach, doch bis zum fertigen Medikament gilt es, viele Hürden zu überwinden. Nebst der rein praktischen Schwierigkeit, ein Radionuklid an ein Bio-Molekül zu koppeln, muss überhaupt erst das richtige Molekül gefunden werden. „Ist das Molekül zu spezifisch, so besteht die Gefahr, dass nicht alle Tumore erkannt werden. Ist es jedoch zu allgemein gestaltet, so kann es womöglich an gesundem Gewebe binden, was zu falsch positiven Diagnosen führt“, erläutert Martin Béhé, Leiter der Gruppe Pharmakologie des Zentrums für radiopharmazeutische Wissenschaften am Paul Scherrer Institut (PSI), die Problematik.
Extrazelluläre Matrix im Visier
Neben Tumoroberflächen existieren für entsprechende Moleküle aber noch weitere mögliche Ziele, zum Beispiel die sogenannte extrazelluläre Matrix, so die Wissenschaftler/-innen. Statt direkt den Tumor anzupeilen, hat es deshalb die Forschungsgruppe um Martin Béhé auf diese extrazelluläre Matrix abgesehen. Bei ihr handelt es sich um den Gewebeanteil, der sich zwischen den Zellen befindet. Man kann sich diesen Raum wie ein dreidimensionales Gerüst vorstellen, in dem die Zelle eingebettet ist; allerdings ein hoch komplexes und flexibles Gerüst, denn die extrazelluläre Matrix steht in permanentem Austausch mit der Zelle und reguliert beispielsweise deren Wachstum und das chemische Gleichgewicht innerhalb der Zelle. Auch in pathologischen Prozessen wie dem Wachstum von Krebszellen spielt die extrazelluläre Matrix eine entscheidende Rolle. So deuten viele Studien darauf hin, dass bestimmte, darin vorkommende Proteine die Lebensfähigkeit von Krebszellen fördern. Tatsächlich konnte gezeigt werden, dass das Tumorwachstum mit einer Umgestaltung der extrazellulären Matrix einhergeht.
Strukturelle Veränderung des Fibronektins
Um die Radionuklide in das Tumorgewebe zu bringen, wollen sich die Forscherinnen und Forscher um Martin Béhé und Viola Vogel, Leiterin des Labors für Angewandte Mechanobiologie an der ETH Zürich, diese Umgestaltung zunutze machen. Konkret beschäftigen sie sich mit einem ganz bestimmten Protein der Matrix, dem sogenannten Fibronektin. In gesundem Gewebe weist das Fibronektin eine ausgestreckte, straffe Struktur auf, welche sich mit zunehmendem Krankheitsverlauf zu lockern beginnt. „Man kann sich das so vorstellen wie bei einer mechanischen Feder. Ist die Feder angespannt, so bestehen zwischen den einzelnen Windungen große Lücken, wo das Medikament nicht anbinden kann. Entspannt sich hingegen die Feder, so schließen sich die Lücken und die Bindungsaffinität steigt an“, so die Analogie von Martin Béhé. Das Fibronektin unterliege also einer strukturellen Veränderung unter Beibehaltung seiner chemischen Zusammensetzung. Diese Veränderung reiche jedoch aus, um die Bindungsaffinität mit gewissen Peptiden signifikant zu steigern, betonen die Wissenschaftler/-innen.
Anreicherung auch in den Nieren
Martin Béhé und sein Team konnten bereits in einer früheren Studie zeigen, dass sogenannte Fibronektin-bindende Peptide (FnBP) als Träger genutzt werden können, um gezielt Radionuklide in die extrazelluläre Matrix eines Tumors zu transportieren. Dafür kombinierten die Forscherinnen und Forscher das Fibronektin-bindende Peptid FnBP5 mit dem radioaktiven Isotop Indium-111. Mithilfe dieses Radiopharmazeutikums ließ sich Prostatakrebs präklinisch erfolgreich aufspüren. Allerdings reicherte sich das Radionuklid nicht nur im Tumor, sondern auch in den Nieren an.
Kommt es jedoch zu hohen radioaktiven Ablagerungen in den Nieren, dann kann dies nicht nur das Bildgebungsverfahren beeinträchtigen, sondern die Nieren könnten auch geschädigt werden. Da die Nieren viele Proteine und Peptide herausfiltern, bevor sie ausgeschieden werden, kann es zu diesen Problemen kommen. Dabei handelt es sich um einen komplizierten Prozess, der dazu führen kann, dass sich die Radionuklide, die an Peptide gebunden sind, lange in der Niere aufhalten, bevor sie schließlich vollständig zerfallen oder anderweitig verarbeitet werden.
Modifizierung des FnBP5-Peptids
Um die Nieren zu schonen, modifizierten die Forscherinnen und Forscher das FnBP5-Peptid mit einem speziellen Protein, das in den Nieren gespalten werden kann. Dieses Protein soll wie eine Brücke zwischen dem ursprünglichen Peptid und dem Radionuklid wirken. Das FnBP5 könne dann immer noch ans Fibronektin andocken und durch das Radionuklid den Tumor sichtbar machen. Allerdings werde, sobald das modifizierte Medikament in die Nieren gelange, das zusätzlich hinzugefügte Protein gekappt und das Radionuklid werde direkt über den Harnweg ausgeschieden. Letztlich konnten die Forscherinnen und Forscher durch diesen molekularen Kniff die Wirksamkeit des ursprünglichen Medikaments beibehalten und gleichzeitig die radioaktiven Ablagerungen in den Nieren reduzieren. Béhé betont: „Wir hoffen, dass unsere Ergebnisse auch für andere Radiopharmazeutika verwendet werden können, die mit ähnlichen Nebenwirkungen verbunden sind.“
Quelle: idw/PSI
Artikel teilen