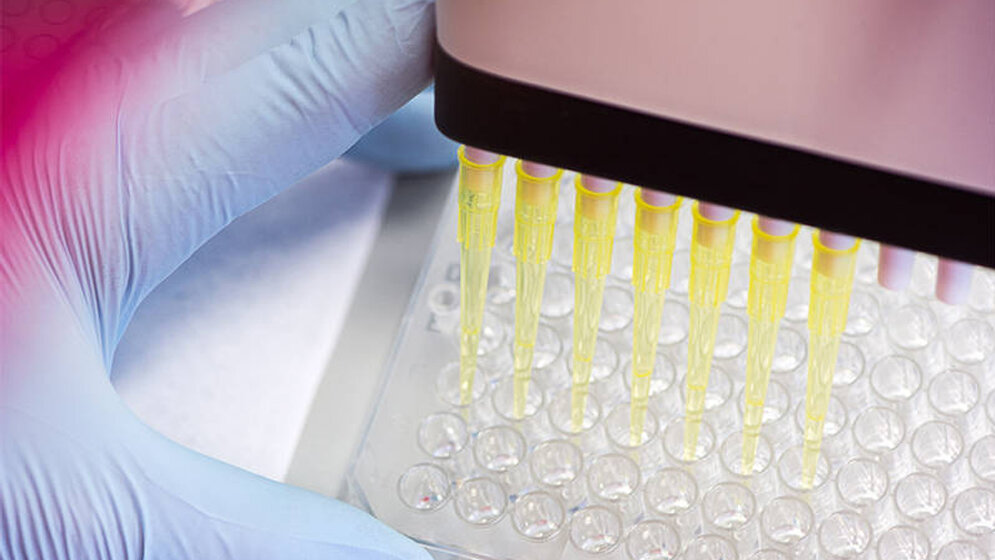Das Immunsystem hat im Laufe der Evolution raffinierte Mechanismen entwickelt, um Virus- und Tumorerkrankungen zu bekämpfen. Ein wichtiger Akteur sind die sogenannten T-Zellen. Sie können Peptide, kleine Proteinstrukturen, auf körpereigenen Zellen erkennen. Die Peptide werden von den Zellen auf der Oberfläche „präsentiert“. Sie zeigen damit an, welche Moleküle in ihrem Inneren stecken. Die präsentierten Peptide können beispielsweise darauf hindeuten, dass eine Zelle von einem Virus befallen oder dass ihr Erbgut mutiert ist – ein Merkmal von Tumorzellen.
Nutzung von Antigenen
Peptide, die von Immunzellen identifiziert werden, werden Antigene genannt. T-Zellen, die Antigene erkennen, können eine Reaktion in Gang setzen, bei der die betroffenen Zellen zerstört werden. In den vergangenen Jahren konnten Forschungsteams, auch an der TUM, diese Eigenschaft erfolgreich für Krebsbehandlungen nutzen. Dafür gibt es verschiedene Ansätze. Eine Impfung mit einem Antigen kann den Körper anregen, verstärkt T-Zellen zu produzieren. Eine andere Möglichkeit ist, T-Zellen anzureichern, die auf bestimmte Antigene „trainiert“ sind, und sie in den Körper zu übertragen.
In beiden Fällen ist es wichtig, zu wissen, anhand welcher Antigene die T-Zellen Viren oder Tumore identifizieren können. Die Zahl der Peptide, die auf körpereigenen Zellen und Krebszellen zu finden sind, ist hoch. Entsprechend groß ist auch die Zahl der potentiellen Kandidaten bei der Suche nach geeigneten Antigenen. Die Autorinnen und Autoren der aktuellen Studie identifizierten allein in Tumor-Gewebeproben von 25 Hautkrebspatienten rund 100.000 unterschiedliche Peptide. Besonders gut erkennen die T-Zellen Peptide auf Tumoren, die Mutationen aufweisen, also in ihrer Struktur verändert sind. Welche Peptide mutiert sind und auf welche Weise sie verändert sind, unterscheidet sich zumeist von erkrankter Person zu erkrankter Person.
Zeitintensive und fehleranfällige Suche
Bislang war die Suche nach den mutierten Peptiden, die tatsächlich auf Tumorzellen präsentiert werden, ein aufwendiger und fehleranfälliger Prozess. Zunächst musste das Erbgut aus Tumorzellen aufgeschlüsselt werden, ein Prozess der schon für sich genommen ein bis zwei Wochen in Anspruch nimmt. Anhand der gewonnenen Daten kann mit Hilfe von Vorhersageprogrammen berechnet werden, welche Peptide mit entsprechenden Veränderungen auf der Zelloberfläche auftreten könnten. Ob diese Moleküle wirklich existieren und auf der Oberfläche präsentiert werden, musste erst in langwierigen Laborversuchen herausgefunden werden.
Ein Team um Angela M. Krackhardt, Professorin für Translationale Immuntherapie in der III. Medizinischen Klinik des Klinikums rechts der Isar der TUM, und Professor Matthias Mann vom Department of Proteomics and Signal Transduction des Max-Planck-Instituts für Biochemie hat eine Alternative zu diesem Prozess entwickelt. Im Fachmagazin „Nature Communications“ schildern Krackhardt und Mann ihren Ansatz. Anders als bisherige Methoden beruht er nicht auf Vorhersagemodellen, sondern darauf, die auf der Tumoroberfläche präsentierten Peptide mithilfe eines Massenspektrometers zu identifizieren. ###more###
Treffsicher und zeitsparend
Auch für die neue Methode wird die Gensequenz, das heißt der Bauplan der Tumorzellen aufgeschlüsselt. Parallel dazu werden die Peptide von der Oberfläche des Tumorgewebes abgelöst und massenspektrometrisch untersucht. Vereinfacht gesagt schlüsselt das Gerät auf, welche Moleküle auf der Gewebeoberfläche der Tumoren präsentiert werden. Bringt man beide Informationen zusammen, lassen sich mit einer hohen Trefferquote die tatsächlich existierenden Antigene, die Mutationen enthalten, finden.
Das Team um Krackhardt und Mann konnte die klinische Relevanz der neuen Methode nachweisen: Im Blut von Hautkrebspatienten fanden sie T-Zellen, die Antigene für die Erkennung von Tumorzellen nutzten, die zuvor mithilfe von Massenspektrometrie identifiziert werden konnten.
Ansatz bietet Vorteile
Der neue Ansatz bietet zahlreiche Vorteile. Dadurch, dass Simulationen und Laborversuche wegfallen, liefert er in deutlich kürzerer Zeit Informationen zu mutierten Peptiden in den Tumorzellen. „Wir haben erstmals nicht nur gezüchtete, genetisch identische Zellen im Massenspektrometer untersucht, sondern inhomogenes Tumorgewebe von realen Patienten“, ergänzt Matthias Mann. „Das erlaubt uns einen viel differenzierteren Blick auf die molekularen Eigenschaften des Tumors.“ Darüber hinaus ist die Methode besonders sensitiv. Dadurch haben sich bereits aus den Daten der aktuellen Studie vielversprechende Forschungsansätze, etwa zur Rolle von phosphorylierten Peptiden ergeben.
Einer klinischen Anwendung der Methode steht Angela Krackhardt zufolge wenig im Wege. „Unser Ansatz eröffnet neue Möglichkeiten für eine personalisierte Behandlung von Krebserkrankungen“, fügt Krackhardt hinzu. „Durch die beschleunigte Identifizierung geeigneter Antigene könnte man in Zukunft innerhalb eines überschaubaren Zeitraums von Wochen bis wenigen Monaten individuelle Impfstoffe oder T-Zell-Therapien für unsere Patienten bereitstellen.“ (TUM, red)
M. Bassani-Sternberg, E. Bräunlein, R. Klar et al.: Direct identification of clinically relevant neoepitopes presented on native human melanoma tissue by mass spectrometry. Nat Commun. 2016 Nov 21;7:13404. DOI: 10.1038/ncomms13404.
Artikel teilen