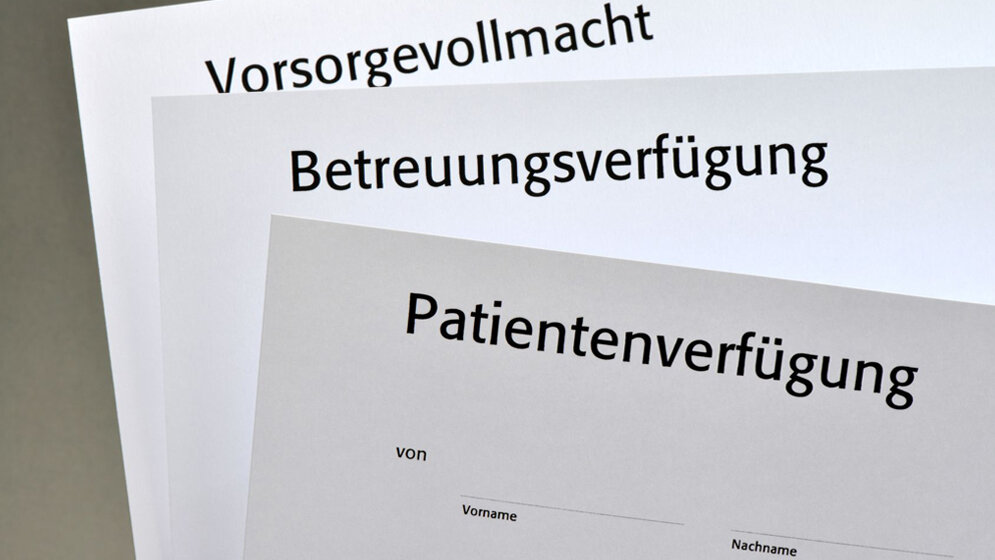Immer mehr Menschen möchten durch eine Patientenverfügung sicherstellen, dass am Lebensende keine medizinischen Maßnahmen gegen ihren Willen erfolgen. Laut einer aktuellen Umfrage begrüßt die Mehrheit der leitenden Intensivmediziner in Deutschland diese Entwicklung. Gleichzeitig stellen sie jedoch fest, dass die meisten Dokumente unzureichend formuliert sind, so dass daraus keine konkreten Handlungsanweisungen abgeleitet werden können. Eine weitere Umfrage unter Beratern ergab, dass viele wichtige Aspekte beim Aufsetzen des Dokuments nicht besprochen werden.
Wer eine Patientenverfügung erstellen will, kann sich in Deutschland an einen Hausarzt oder einen Notar wenden. Krankenhäuser bieten Gespräche mit sogenannten Überleitungsfachkräften an. Viele Hospizvereine haben ebenfalls ausgebildete Mitarbeiter, die Patienten beim Erstellen einer Verfügung unterstützen. Sabine Petri vom Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München hat 198 Berater der verschiedenen Berufsgruppen im Raum München nach ihrem Vorgehen befragt.
In den meisten Fällen dauerten die Beratungsgespräche bis zu 60 Minuten und umfassten ein bis zwei Termine. Dabei kamen die Themen „Flüssigkeitszufuhr und Ernährung“, „dauerhafte Bewusstlosigkeit“ und „tödliche Erkrankung“ am häufigsten zur Sprache. Jedoch wurde in weniger als der Hälfte der Fälle „Notfallpläne“ erstellt. Diese enthalten Maßnahmen wie Reanimation, Bluttransfusion oder Beatmung und ermöglichen den verantwortlichen Ärzten ein schnelles Handeln. Zudem mündeten nur zwischen 29 und 51 Prozent aller Beratungen in einer fertigen Verfügung, schreibt Petri.
Sie vermisste auch, dass häufig keine Angehörigen am Gespräch beteiligt waren. Diese seien später oftmals ein wichtiger Ansprechpartner, um bei unklaren Patientenverfügungen den mutmaßlichen Willen des Patienten herauszufinden.
Denn tatsächlich sind die wenigsten Verfügungen so klar formuliert, dass Intensivmediziner sie umsetzen können. Susan Langer vom Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft an der Universität Halle-Wittenberg hat hierzu 222 leitende Intensivmediziner größerer Krankenhäuser befragt. Rund 71 Prozent der Mediziner gaben an, dass sie Patientenverfügungen generell als hilfreich empfänden. Gleichzeitig bemängeln 90 Prozent, dass in der Praxis die Behandlungswünsche der Patienten nicht klar genug definiert seien und die Dokumente den konkreten Krankheitsfall selten bis nie abdeckten.###more###
Die Mediziner sehen sich häufig mit der grundsätzlichen Ablehnung einer Maßnahme konfrontiert, ohne dass definiert sei, in welchen Fällen die Behandlung nicht erwünscht sei. So kann eine Beatmung helfen, eine lebensbedrohliche Krise zu überwinden, sie kann aber auch den Tod eines bewusstlosen Patienten um Tage oder Wochen hinauszögern, ohne dass eine Chance auf eine Erholung besteht.
Dennoch beugt sich die Mehrheit der befragten Intensivmediziner dem Willen der Patienten: Etwa 79 Prozent waren zum Abschalten der Atemgeräte bereit, auch wenn dies 55 Prozent der Ärzte als belastend empfanden. Darüber hinaus wünschten sich mehr als 80 Prozent, dass Angehörige häufiger eine Vorsorgevollmacht haben sollten, um mit ihnen das Vorgehen zu bestimmen.
Petri und Langer fordern angesichts dieser Ergebnisse eine Standardisierung der Beratungsgespräche. Beide sehen im Konzept „Advance Care Planing“ eine Chance, die Qualität von Patientenverfügungen zu verbessern. Das Konzept sieht vor, Patienten und ihre Angehörige bei einer tödlichen Erkrankung frühzeitig detailliert in die Behandlungsplanung einzubeziehen und über die Optionen zu informieren. Dabei werden die Behandlungswünsche nicht festgeschrieben, sondern können im Behandlungsprozess den Erfahrungen des Patienten immer wieder angepasst werden.
Quellen:
S. Petri und G. Marckmann: Beratung zur Patientenverfügung. Eine Studie zur Beratungspraxis ausgewählter Anbieter in der Region München. DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift 2016; 141 (9); e80–e86
S. Langer et al.: Umgang mit Patientenverfügungen in Deutschland. Sichtweisen leitender Intensivmediziner. DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift 2016; 141 (9); e73–79
Artikel teilen